Die Arbeitspakete/Work Pakages (WP`s) im Projekt
Arbeitspaket 1 (WP1)
Sammeln von Patientenmaterial
und Daten
Dr. Else Marit Inderberg
IPerGlio Projekt Koordinatorin & Leitung

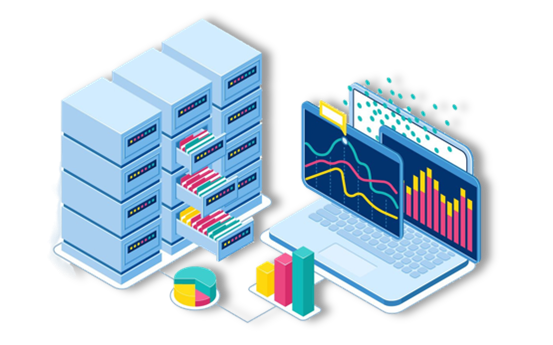
Das Glioblastom stellt ein offenes Problem in der Krebsmedizin dar, da weder Präventivmaßnahmen noch Frühdiagnoseverfahren zur Verfügung stehen und die Therapien kaum wirksam sind. In diesem düsteren Kontext ist das Zusammenspiel zwischen dem Wirt (d. h. dem menschlichen Körper und dem Gehirn, in dem sich der Tumor entwickelt) und dem Tumor selbst ein vielversprechendes Forschungsgebiet. Das Hauptziel des IPerGlio-Projekts besteht darin, die Gründe zu erforschen, warum die „Polizisten“ unseres Körpers, unser so genanntes „Immunsystem“, nicht in der Lage sind, das Glioblastom wirksam zu bekämpfen, und die Grundlage dafür zu schaffen, diese Situation zu ändern. In Arbeitspaket 1 werden wir Daten über den klinischen Zustand, den Lebensstil, die psychologischen und die Ernährungsgewohnheiten von 260 GBM-Patienten sammeln, die in zwei großen akademischen Referenzkrankenhäusern, dem Oslo University Hospital (Norwegen) und der Fondazione Policlinic Gemelli in Rom (Italien), behandelt werden. Wir werden auch biologische Proben von diesen Patienten sammeln. Diese Daten und Materialien werden in den anderen Arbeitsgruppen des IPerGlio-Projekts eingehend analysiert. Es werden strenge Verfahren festgelegt, um die vollständige Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten, einschließlich der Anonymisierung der Daten.
Arbeitspaket 2 (WP2)
Herausfinden, warum Immunzellen Glioblastom-Tumorzellen nicht erkennen oder angreifen
Prof. Roberto Pallini

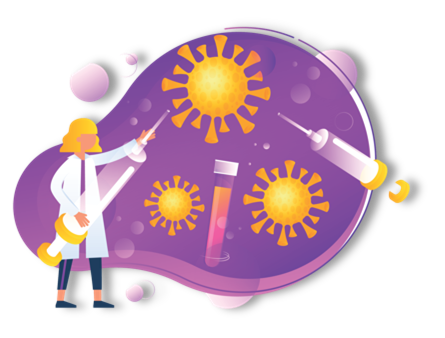
Im Zusammenhang mit der GBM-Forschung ist ein besseres Verständnis der Immunprofile (d. h. wie und wie gut das Immunsystem einer Person auf Krebs reagiert) von großer Bedeutung. Es ist inzwischen weithin anerkannt, dass Immunzellen unter pathologischen Bedingungen, wie z. B. bei der Tumorentwicklung, in der Lage sind, die Blut-Hirn-Schranke zu durchbrechen, einen starken Filter um das Gehirn, der nur bestimmte Substanzen aus dem Blut ins Gehirn durchlässt. Allerdings gelingt es diesen Immunzellen oft nicht, den Tumor zu erkennen und zu bekämpfen. Dies hängt mit der Art und Weise zusammen, wie bestimmte Gene exprimiert werden, die als Marker für die Funktionsfähigkeit der Immunzellen dienen. Vor diesem Hintergrund besteht das Hauptziel von WP2 darin, die umfassende Genexpression von Immunzellen im Tumor zu untersuchen. Dies wird durch die Analyse von Blut- und Tumorproben erreicht, die von Patienten stammen, die an dem Forschungsprojekt teilnehmen. Wir gehen davon aus, dass wir bei den einzelnen Patienten unterschiedliche Immunprofile feststellen werden, was uns die Möglichkeit bietet, personalisierte Behandlungsoptionen mit Hilfe der Immuntherapie zu erforschen. Derzeit ist die Immuntherapie eine wirksame und vielversprechende Behandlungsmöglichkeit für viele Krebsarten.
Arbeitspaket 3 (WP3)
Prüfung von Tumor- und Immunreaktionen bei ausgewählten Patienten
Dr. Lucia Gabriele


Im WP3 des IPerGlio-Projekts möchten wir bei ausgewählten Patienten, von denen wir genügend Proben haben, testen, welche Arten von Mutationen im Tumor vorhanden sind. Mutationen im Tumor können dazu beitragen, dass die Immunzellen den Tumor leichter erkennen, weil sich der Tumor dadurch von gesundem Gewebe unterscheidet.
Wir werden auch Immunzellen aus den Tumoren züchten und testen, ob sie gegen die Tumorzellen oder die in den Tumorzellen gefundenen Mutationen reagieren können. Dies kann im Labor getestet werden, indem Moleküle gemessen werden, die von den Immunzellen produziert werden und eine positive Immunreaktion hervorrufen.
Wenn dies der Fall ist, könnte dies bedeuten, dass die Immuntherapie eine natürliche Immunreaktion verbessern könnte, um effektiver zu werden.
Arbeitspaket 4 (WP4)
Datenintegration durch Business Intelligence
Dr. Antonio Cosma


In WP4 ist unser Hauptziel, eine öffentliche Datenbank zu erstellen, die alle Arten von wissenschaftlichen, klinischen und umweltbezogenen Informationen zusammenführt, die vom IPerGlio-Konsortium gesammelt wurden. Wir hoffen, dass dies es anderen Forschern ermöglicht, noch mehr über GBM und die Reaktion des Immunsystems darauf herauszufinden.
Wir sind stets bemüht, die Daten sauber und übersichtlich zu halten. Aus diesem Grund verwenden wir spezielle Tools, die in erster Linie für den Wirtschaftsbereich entwickelt wurden, um die Daten besser sehen und verstehen zu können und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir besser informierte Entscheidungen treffen können. Wir werden auch dafür sorgen, dass diese Datenbank für alle Projektteilnehmer leicht zu durchsuchen ist.
Sie soll einfach, übersichtlich und interaktiv sein, so dass jeder das findet, was er braucht, und es auf eine optisch ansprechende Weise erkunden kann.
Arbeitspaket 5 (WP5)
Entwicklung von KI-Modellen, die eine wirksame Kombination von Behandlung und Immuntherapie vorhersagen können
Prof. Marcos J. Araúzo-Bravo


Im 5. Arbeitspaket (WP5) des Projekts werden wir im Rahmen von KI-Ansätzen Modelle für maschinelles Lernen (ML) entwickeln, um kritische Immunvariablen und LE-Faktoren, die für die GBM-Prognose relevant sind, zu suchen und zu identifizieren. Da die spezifische Datenstruktur mit einer moderaten Anzahl von Stichproben und einer hohen Anzahl von Variablen nicht ideal für die Ableitung von ML-Modellen ist, werden Techniken zur Reduzierung der Multidimensionalität, wie z. B. Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME), angewandt, um Modelle zu entwickeln, die für das Lernen unter einer moderaten Anzahl von Stichprobenbedingungen robuster sind, wobei unsere neue „Learning with Exceptions“-Technologie (LwE) verwendet wird. Dieser Ansatz wird es uns ermöglichen, die Daten anzupassen und die Dimension des Suchraums zu reduzieren, indem wir wichtige Variablen durch Omics-Techniken identifizieren.
Arbeitspaket 6 (WP6)
Einbeziehung von Patienten und Interessenvertretern, ethische Analyse der klinischen Forschung und des Einsatzes von KI
Dr. Ruben Andreas Sakowsky


Um sicherzustellen, dass die IPerGlio-Forschung auf ethisch verantwortungsvolle Weise durchgeführt wird, führen wir zwei Online-Konferenzen durch, um verschiedene europäische Interessengruppen zu erreichen und von ihren Perspektiven zu lernen. Die beiden Konferenzen werden sich mit zwei unterschiedlichen ethischen Aspekten befassen:
a) Ethische Bedenken hinsichtlich der Veröffentlichung von Forschungsdaten in einer öffentlichen Datenbank – im Jahr 2024
b) Die Beziehung zwischen KI-Systemen und menschlichem Gesundheitspersonal bei der Entscheidungsfindung und die Auswirkungen von KI-Systemen auf die Beziehung zwischen Arzt und Patient – im Jahr 2025
Stakeholder Consensus Conferences (SCC) sind ein etablierter deliberativer Ansatz für die Beteiligung von Stakeholdern, der es verschiedenen Interessengruppen wie Vertretern von Patientenorganisationen, Angehörigen der Gesundheitsberufe und Fachleuten ermöglicht, gleichberechtigt zusammenzukommen. SCCs bringen zehn bis zwanzig Stakeholder zusammen, die als Vertreter von Akteuren definiert sind, die wahrscheinlich von den aus dem Projekt resultierenden Ergebnissen und Maßnahmen betroffen sind (z. B. Angehörige der Gesundheitsberufe, Patienten, Experten), und dauern mehrere Tage. Durch gegenseitiges Lernen und den Austausch von Argumenten werden die Teilnehmer ermutigt, sich einem fundierten Konsens anzunähern und ein Ergebnisdokument zu erstellen, in dem sie ihre ethischen Empfehlungen festhalten.
Da dies eines der ersten Beispiele für die Nutzung von Online-Technologien für SCCs ist, werden wir auch wertvolle Erkenntnisse über künftige Möglichkeiten der Online-Patientenbefähigung gewinnen.
Die anschließende ethische Analyse wird die Ergebnisse der SCC in die breitere bioethische/datenethische Debatte einordnen. Wir werden die ethischen Grundsätze ermitteln, auf die sich die Interessengruppen der SCC berufen, und die Gründe für die Perspektiven der Interessengruppen untersuchen. Außerdem werden wir die Möglichkeiten und Herausforderungen der Online-Beratung untersuchen, um einen fruchtbaren Dialog zu ermöglichen.
Arbeitspaket 7 (WP7)
Projektleitung und -koordination
Dr. Else Marit Inderberg
IPerGlio Projekt Koordinatorin & Leitung


Um die IPerGlio-Ziele zu erreichen, werden wir eine gute Kommunikation zwischen den Projektpartnern und der Europäischen Kommission (EK) sicherstellen, indem wir bis Monat 3 einen Projektmanagementplan erstellen, eine regelmäßige Kommunikation über Patientenproben, Sendungen und Datenanalysen aufrechterhalten und halbjährliche Fortschrittssitzungen sowohl online als auch persönlich abhalten. Wir entwickeln einen Risikomanagementplan, den wir der Europäischen Kommission bis Monat 6 vorlegen, und führen eine SWOT-Analyse durch, um Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für die strategische Entscheidungsfindung zu ermitteln. Wir werden jährliche und abschließende wissenschaftliche und finanzielle Berichte erstellen, in den ersten zwei Monaten ein Kick-off-Meeting durchführen, um den Zeitplan und die zu erbringenden Leistungen zu besprechen, drei technische und finanzielle Berichte sowie drei Zwischenberichte für interne Diskussionen erstellen und wissenschaftliche Ergebnisse und Veröffentlichungen über eine Projektwebsite und soziale Medien verbreiten. Zu den zu erbringenden Leistungen gehören der Projektmanagementplan, Daten- und Risikomanagementpläne sowie Jahres- und Abschlussberichte für die Europäische Kommission.





